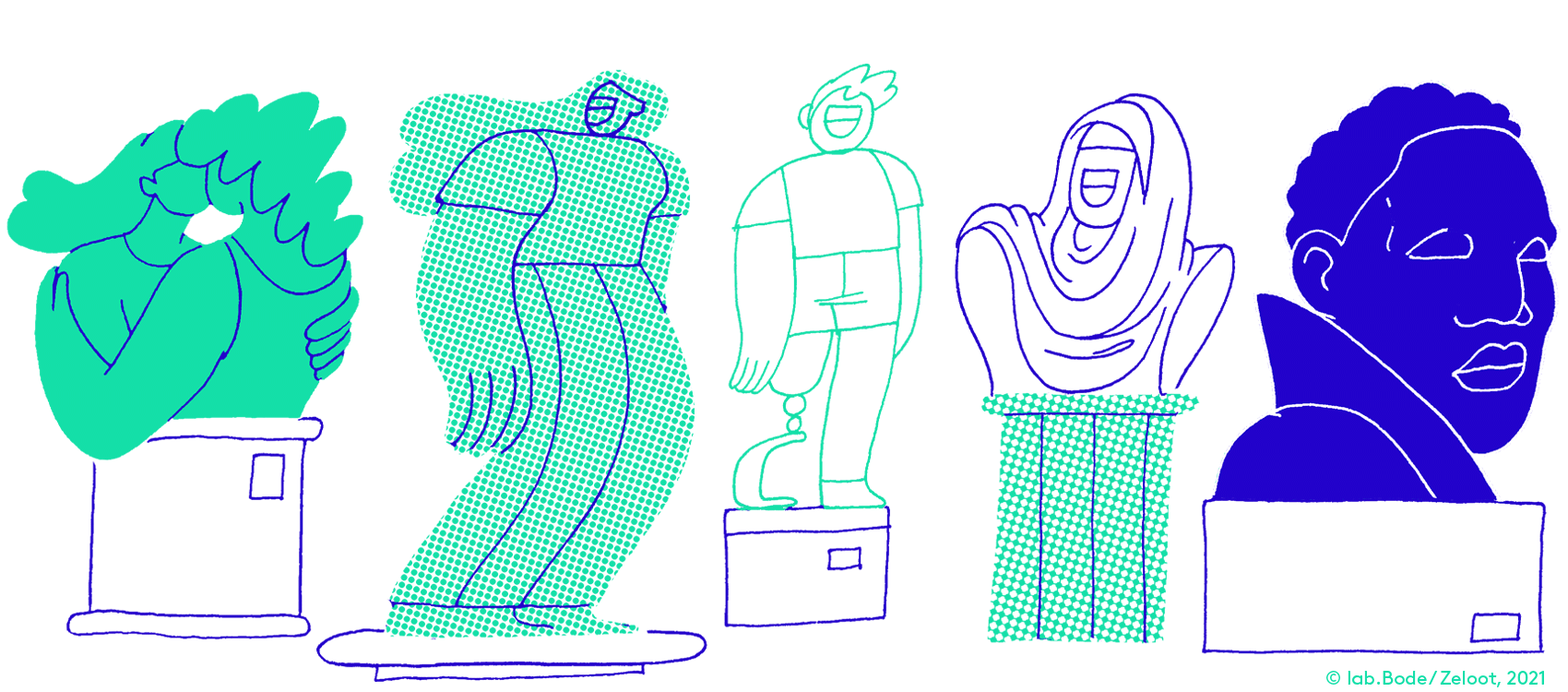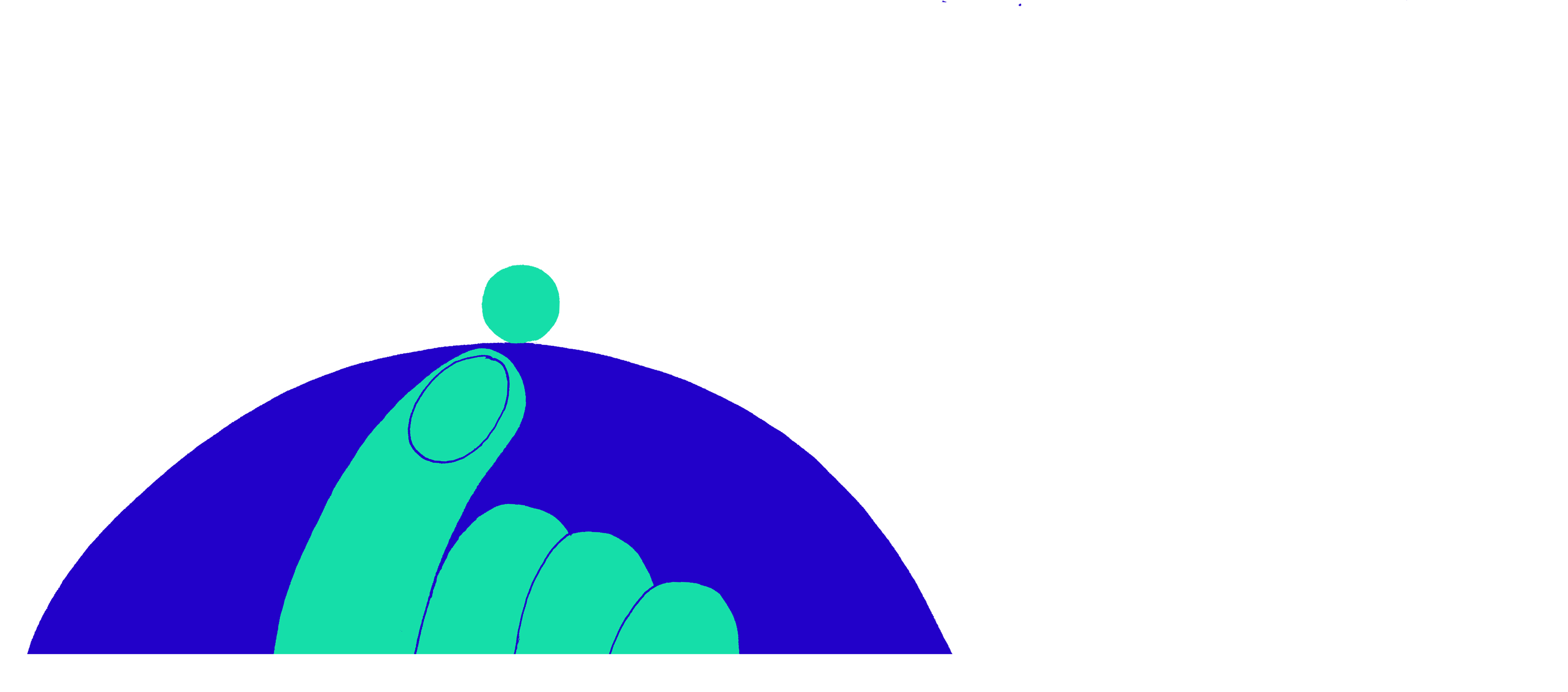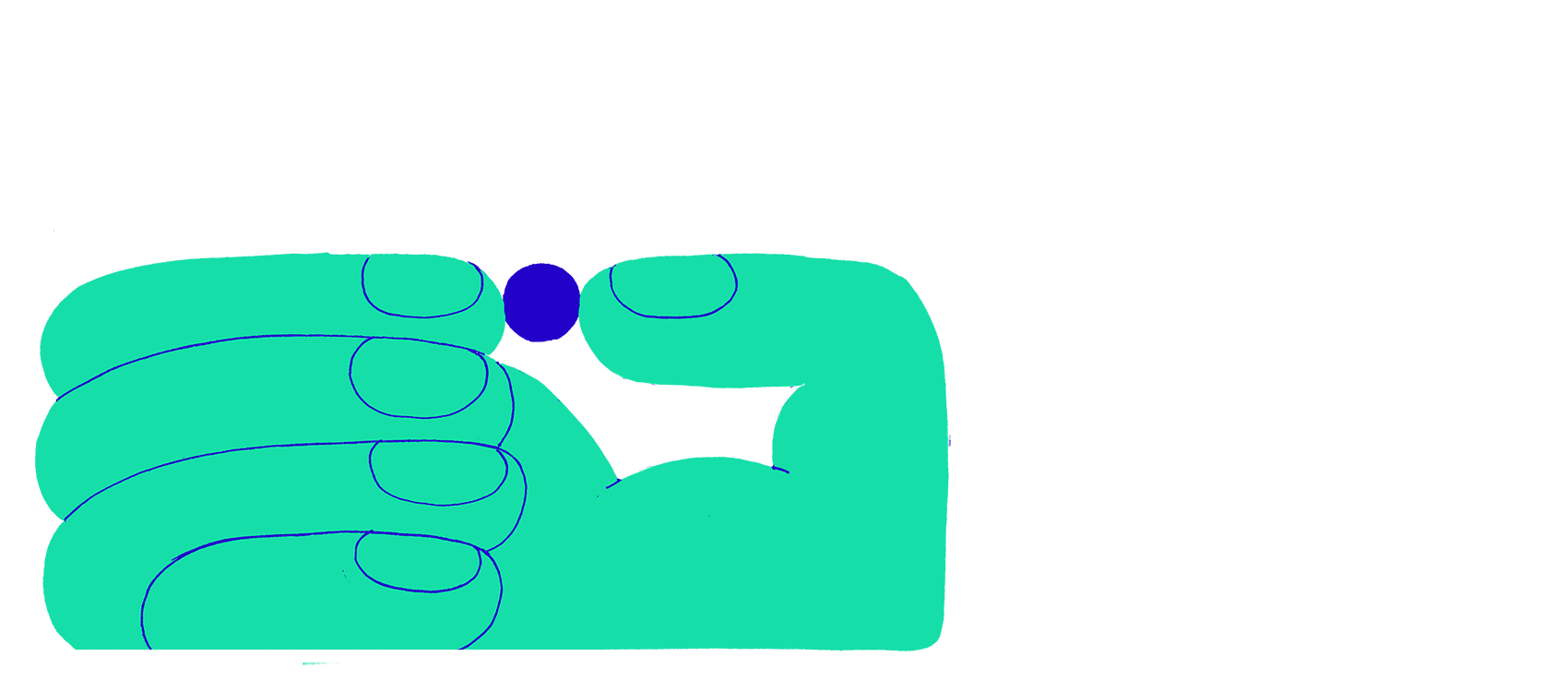Unser Text reflektiert die historisch gewachsene koloniale Verfasstheit der Institution Museum und deren Kontinuitäten in der Gegenwart. Dabei beschäftigen uns die Effekte dieser Kolonialität auf ge-anderte Besucher*innen und potentiell auch Museumsarbeiter*innen in Hinblick auf Ausschlusserfahrungen und auf zusätzlich zu leistende emotionale Arbeit. Ein Schwerpunkt unserer Betrachtung liegt auf der Ungleichheitskategorie Rassifizierung. Denn gerade weiße Akteur*innen, die sich selbst als kritisch gebildet und progressiv eingestellt verstehen, produzieren weiterhin Leerstellen beim Lesen der Institution und in ihrem professionellen Handeln, wenn es um Rassifizierung geht. Zur Verdeutlichung dessen nimmt der Text beispielhaft Unternehmungen des Bode-Museums und des lab.Bode in den Blick, die seitens der Institution jeweils für eine inklusive Haltung des Ausstellens und Vermittelns im Museum stehen: Die Ausstellung Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum und das Vermittlungsprojekt „anders sein“, das mit einer Schulklasse in diese Ausstellung kritisch intervenierte. Schließlich skizzieren wir mögliche Zugänge für eine diskriminierungskritische Praxis im Museum. Wir bieten aber keine Lösungen an, denn die kann es angesichts der epistemischen Gewalt des Museums so nicht geben. Damit ist die Gewalt gemeint, die im eurozentrischen Wissen selbst, in seinem Zustandekommen, seiner Ausformung und seiner Art zu wirken liegt. Museen sind, so unsere Forderung, als zentrale Einrichtungen der Wissensproduktion verpflichtet, die Fortsetzung epistemischer Gewalt zu unterbrechen. Deswegen sind sie aufgefordert, sich diskriminierungskritisch zu bilden und zu wandeln.
“[…] the struggle of our new millennium will be one between the ongoing imperative of securing the well-being of our present ethnoclass (i.e., Western bourgeois) conception of the human, Man, which overrepresents itself as if it were the human itself, and that of securing the well-being, and therefore the full cognitive and behavioral autonomy of the human species itself/ourselves. […] all our present struggles with respect to race, class, gender, sexual orientation, ethnicity, struggles over the environment, global warming, severe climate change, the sharply unequal distribution of the earth resources […] —these are all differing facets of the central ethnoclass Man vs. Human struggle.“1
I. Historische gewachsene Verhältnisse
Carmen Mörsch
Die Vorläufer der öffentlichen Museen waren fürstliche Sammlungen und Zurschaustellungen von – wesentlich auch kolonialem – Reichtum. Der Zugang war nur Privilegierten gestattet. Damit war ab der französischen Revolution allmählich Schluss: Beginnend in Frankreich und England fand die Überführung der Repräsentationsräume des Adels in öffentlich zugängliche Museen statt. Doch „öffentlich“ adressierte von Beginn an eine bürgerliche, weiße und vornehmlich männliche Öffentlichkeit.2 Spätestens im Zuge der Stärkung und Institutionalisierung der sozialen Bewegungen im 19. Jahrhundert – der Arbeiter*innenkämpfe, der Antikolonialen Kämpfe, der Kämpfe um die Gleichstellung der Geschlechter, das Wahlrecht und so weiter – wurden öffentliche Museen Reformprojekte. Sie stellten Teil eines Kompromisses dar, um den Druck der Bürgerrechtsbewegungen zu befrieden, ohne dass das eigene (weiße, männliche, bürgerliche) Privileg dabei ernsthaft Schaden nehmen müsste. Denn Museen boten durch visuellen Konsum eine symbolische Form der Teilhabe am Reichtum, der reale Umverteilung umging. Sie wandelten sich zu bürgerlichen Bildungs- und Zivilisierungsanstalten für die aus Herrschaftsperspektive bedrohlichen Massen. In Deutschland entstanden viele öffentliche Museen im ausgehenden 19. Jahrhundert im Zuge der Reichsgründung; sie waren gleichermaßen bürgerliche Prestige- wie auch Erziehungsprojekte im Sinne der nationalen Einheit, eng verbunden mit der Volksbildungs- und der Heimatbewegung. Zusammengefasst: Museen dienten der Rechtfertigung des staatlichen Besitzes von im Rahmen von Eroberungskriegen und Kolonialisierung geraubten Kulturgütern; der Verbreitung nationaler Gründungsgeschichten, zur Bildung von Nationalbewusstsein in der Bevölkerung; und sie dienten der Disziplinierung der Arbeiter*innenschicht im Sinne bürgerlicher Lebenskonzepte. Sie waren zudem eine Antwort auf die Notwendigkeit ästhetischer Bildung (im Sinne von gestalterischen Fertigkeiten und von Geschmacksbildung) zur Sicherung von Kapazitäten im Rahmen des wirtschaftlichen, globalen/kolonialen Wettbewerbs.
Das Museum ist historisch betrachtet also eine ausgesprochen ambivalente Institution. Einerseits, wie feministische, post- und dekoloniale Kritiken schon lange herausarbeiten, steht das Museum also für die sozialen Ausschlüsse und die Normalisierung der Gewaltverhältnisse der westlichen bürgerlichen patriarchalen weißen Dominanzgesellschaft – die Institution ist seit ihrer Entstehung geprägt von Kolonialität.3 Andererseits steht das institutionelle Selbstverständnis des Museums für das Humboldt’sche Bildungsideal und für die freie Selbstentfaltung des bürgerlichen Subjekts. Ideen der Demokratisierung von Bildung und der Künste als Teil des öffentlichen Lebens, auf den sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft einen Anspruch haben, sind in die Museen als Potential eingeschrieben.
Die Debatte um „Zugang“ nahm seit den ersten Gründungen von öffentlichen Museen und Ausstellungsinstitutionen die Besucher*innen in den Blick. Zu Beginn stand die heiß diskutierte Frage, wer überhaupt in ein Museum hineindarf.4 Im 19. Jahrhundert ging es dann darum, wer das Museum zu Erziehungszwecken besuchen soll: zuerst Arbeiter*innen (Proletarier*innen) und ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend als „Migrant*innen“ markierte Subjekte. Was dabei auf Entscheidungsseite kaum hinterfragt wurde, war, wer diese Institutionen gestaltet: Wer bestimmt, was sie sammeln und bewahren und was und wie sie zeigen; welches Wissen, welche Erzählungen in ihnen produziert und weitergegeben werden; wer in ihnen und mit ihnen Geld verdient. Der weiße, bürgerliche Alleinanspruch auf die Definitionsmacht in Museen erscheint quasi-natürlich, ist jedoch seit langer Zeit umkämpft: Ebenfalls schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es Museen zur Bewahrung, Sammlung und Repräsentation der aus dem hegemonialen Museum ausgeschlossenen Geschichten.5 Allerdings hatten solche Gründungen von „anderen Museen“ (von denen es ab den 1930er-Jahren und mit einem Boom in den 1980er-Jahren inzwischen zahlreiche gibt) bislang kaum Effekte auf die Personal- und Wissensstrukturen der hegemonialen Museen: Es gibt „die Museen“ und „die besonderen Museen“. Wie zäh „die Museen“ an ihrem Allgemeinanspruch festhalten, wurde zum Beispiel am 7. September 2019 ein weiteres Mal deutlich, als es den Vertreter*innen aus 24 Nationalkomitees des ICOM gelang, auf der Außerordentlichen Generalversammlung in Kyoto einen Aufschub des Beschlusses über eine neue Museumsdefinition durchzusetzen. In dieser neuen Museumsdefinition kamen Begriffe wie „Partizipation“, „Inklusion“, „Diversität“ und „soziale Gerechtigkeit“ vor. Dabei handelt es sich um Begriffe, die in Fachdiskussionen der kritischen Museologie und insbesondere der Vermittlung ihrerseits schon nicht mehr per se als transformativ gelten, sondern in Hinblick auf ihre dominanzerhaltenden Funktionen diskutiert werden. Trotzdem erschienen sie den Vertreter*innen der ICOM (und insbesondere der deutschen Delegation) als „zu politisch“.6 In der Weigerung, das vermeintlich „unpolitische“ Handeln der Museen in seinen Machteffekten zu reflektieren, artikuliert sich auf beispielhafte Weise Kolonialität; respektive, eurozentrististische, rassisistische, sexistische und klassistische, weiterhin belohntes Nichtwissen – „jene Ignoranz also, die nicht blamiert, sondern gegenteilig die eigene Position der Macht stabilisiert.“7
II. Kontinuitäten in der Gegenwart
Peggy Piesche
Gleichzeitig scheint die Frage, warum Museen Diskriminierungskritik brauchen, fast schon obsolet zu sein. Sind doch zurzeit, unbenommen der oben geschilderten Konflikte im Rahmen der ICOM, die Antworten in aller Munde. Zumindest als Schlagwörter wie Barrieren abbauen oder Zugänglichkeit erhöhen: Diversität scheint gerade trendy zu sein, nicht selten als diversity outreach oder diversity Strategie. Das Neudeutsch-Englisch scheint bereits Hürden abzubauen, Hürden des Widerstands weißer Hegemonie. Es fühlt sich nicht so bedrohlich an wie die deutsche Diversität. Diversity ist wie Vielfalt, ist positiv, lässt alle zusammenkommen und Schuld, Scham und Verantwortung für historische Ungleichheitsdimensionen erstmal vergessen. Und nur so erscheint es aus institutioneller Sicht möglich, das, was Diskriminierungskritik will, auch umzusetzen. Das eigentliche Konzept dahinter wird jedoch selten wirklich bemüht. Das nämlich fordert dazu auf, innezuhalten in der Verstörung, die spürbar wird, wenn das Ausmaß der Barrieren, der Erblast kolonialer Gewalttaten und deren permanente kulturelle Repräsentationen, der Reproduktion von (Fremd-)Zuschreibungen und Zugehörigkeiten, der Wirkmächtigkeit von Weißsein und der damit verbundenen Unzugänglichkeit des Museums bewusst werden. Museumsverantwortliche nehmen dies durchaus wahr und verspüren, was historisch gewachsene und immer wieder abgerufene Ungleichheitsdimensionen sind. Aber sie handeln bislang in aller Regel nicht aus dieser Wahrnehmung heraus, machen diese Verstörung nicht fruchtbar. Vielmehr berufen sie sich auf vermeintlich objektive und universelle Strukturen und wollen vor allem schnell handeln: Etwas anders machen, das Verstörende verändern. An diesem Punkt drängt sich das Fragewort auf: Warum?
Das war auch meine erste Frage, als ich zum ersten Mal in die Ausstellung Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum gesehen habe. Ich hatte schon vorab – draußen – ein fades Gefühl, das sich im Magen breit macht, wenn sich das Archiv der kolonialen, markierenden und rassistischen Symbolik wieder – nicht unerwartet – öffnet. Das mit roter Farbe gemalte Kreuz, das in seiner plastischen Darstellung den Akt des (Durch-)Streichens geradezu plump aufdrängt, fand ich schon schwer verdaulich. Den Film vorm inneren Auge, wie mit einem Töpfchen roter Farbe Orte markiert, gestrichen, durchgestrichen werden, kann ich in einem deutschen historischen Kontext nicht wertfrei betrachten. Die „Markierung der Anderen“ ruft in mir eine kollektive Empathie auf, die leider nicht so universell verstanden wird, wie die institutionelle Interpretation und deren Ausstellungspraxen. Im Museum selbst überkam mich sofort das Gefühl der Deplatzierung – ein Gefühl, das sich aus dem Verstehen und zu tiefsten Empfinden von Anderungsprozessen8 einstellt. Die „Einladung“, dass hier etwas „Anderes“ gezeigt und in einen Vergleich mit dem „Eigenen“ gestellt wird, wurde sofort ausgesprochen. Wenn ich ins Museum gehe und sofort angeboten bekomme, dass ich oder die Besucher*in neben mir genau dieser Ausstellungsteil des als „anders“ markierten in dem „Unvergleichlichem“ bin, dann frage ich mich unwillkürlich: Warum? Warum sollte mich diese Ausstellung ansprechen? Warum müssen bei der Ausstellung von Kunst aus Afrika und Europa Prozesse der Rassifizierung – buchstäbliche Markierungen, Anderungen – erneuert und reproduziert werden? Und schließlich: Warum trifft es mich, warum bestätigt das Ausstellungsformat weiße Besucher*innen, aber erlaubt mir als Schwarze Besucher*in eine solche Bestätigung nicht?
Nun könnte ich hier abkürzen und schreiben, dass wir genau deshalb Diskriminierungskritik im Museum brauchen. Damit sich BPOC-Besucher*innen aller Generationen nicht solche Fragen stellen müssen und nicht diesen faden Gefühlen ausgesetzt sind. Doch die Sache ist komplexer. „Warum“ ist nicht die einzige Frage, die zugegebenermaßen zuerst und meist emotional motiviert aufkommt. Wer sich ernsthaft mit dem Konzept der Diskriminierungskritik im Museum beschäftigen will, sollte mehr Fragen stellen. Dabei meine ich nicht die Fragen, die sich kulturphilosophisch beim Ausarbeiten und Beschreiben des Ausstellungskonzeptes stell(t)en, aber irgendwie nicht wirklich beantwortet werden: „Jeder Museumsbesuch fordert auf, Objekte zu vergleichen und zu interpretieren. Doch was bedeutet es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen? Die Ausstellung wirft mehrere Fragen auf: Welche Erkenntnisse werden durch die gemeinsame Präsentation von Kunstwerken mit unterschiedlichen Geschichten gewonnen? Was für Auswirkungen hatte es, Objekte, die einst gemeinsam in der Brandenburgisch-Preußischen Kunstkammer standen, verschiedenen Museen zuzuordnen? Warum wurden die einen Objekte als ethnologische Gegenstände und die anderen als Kunstwerke klassifiziert?“9 Ich bin ein großer Fan der Sesamstraßenfragen und finde, dass sie fast alle (philosophischen) Fragen dieser Welt beantworten. Wir müssen sie nur richtig stellen. Auffällig im Konzept der Ausstellung ist, dass sich die Fragen vor allem auf das Epistemische richten: Wissen, Erkenntnisse und Ordnungsprinzipien werden also hier abgerufen und Bedeutungen eingefordert, die auf eben jenen Konzepten basieren. Aber, das Epistemische, also das Wissen, die Erkenntnisse und die Ordnungsprinzipien, sind nicht neutral, nicht universell und ihre jeweilige Positionalität – der Ort, von dem sie sprechen, die kollektive Identität/Bedeutung, die sie einnehmen – wird erst dann deutlich und besprechbar, wenn die Sesamstraßenfragen richtig gestellt werden.
Wer*… wird als handelnde Person/Gruppe angesprochen? … wird als nicht-handelnde Person/Gruppe angesprochen? … profitiert von einer solchen Ansprache? Wie … funktionieren die Ansprachen? … werde ich angesprochen? … bin ich hier beteiligt/verortet? Was … nehme ich wahr? … nehme ich nicht wahr? … macht das mit mir? Wozu … wird diese Botschaft vermittelt? Weshalb … passiert dieser Konflikt jetzt / wird jetzt offenkundig? Und genau dann erschließt sich die Frage des Warums: Warum verunsichert oder bestätigt mich das?
III. Diskriminierungskritische Perspektiven für das Museum – ernsthaft, jetzt!
Peggy Piesche und Carmen Mörsch
Diskriminierungskritik ist bereit, sich den hier genannten Fragen zu stellen und sie in einer prozessorientierten Suchbewegung zu beantworten. Diskriminierungskritik ist, in der Verstörung bei jeder Frage zu bleiben und das, was sich als Arbeitsaufträge daraus ergibt, ernst- und anzunehmen. Die Arbeitsaufträge lassen sich nicht abkürzen und diese Erfahrung haben viele Kunsteinrichtungen und hier vor allem ihre Vermittlungsbereiche schon hinlänglich gemacht. Kurze, knackige Workshops mit Handlungsleitfäden für den täglichen musealen Betrieb bringen nichts.
Selbst bei einem avancierten Kunstvermittlungsprojekt wie die im Kontext von Unvergleichlich mit Schulklassen des Thomas-Mann-Gymnasiums entwickelte Ausstellungsintervention wurde uns als Betrachter*innen (bei aller Begeisterung für die tollen Schüler*innenarbeiten) schnell klar, wer beziehungsweise was hier das „Andere“ ist: „anders sein“, so der Projekttitel10, ist quasi die Begrüßung, die (einige) Besucher*innen bereits beim Eintreten angeboten bekommen. Da ist es dann eigentlich egal, was danach kommt. Egal, wie eloquent die analytische Beschreibung, die epistemische Kontextualisierung des Konzepts. Zwar war die intensive kritische Auseinandersetzung der Schüler*innen mit Prozessen der „Veranderung“ den Ergebnissen deutlich abzulesen. Doch bildete auch in diesem Projekt die Epistemologie der Alterität zwangsläufig weiterhin die Grundlage, auf der sich abgearbeitet wurde. Das korrespondiert mit der – unabhängig von der guten finanziellen Ausstattung – Unerfüllbarkeit des an das Projekt lab.Bode gerichteten Auftrags, das Museum in Richtung weniger Gewalt und Ausschluss zu verändern: Nicht zum ersten Mal wird dieser Auftrag an die Vermittlung delegiert, also an eine strukturelle Stelle mit sehr wenig institutioneller Handlungsmacht. Damit soll nicht gesagt sein, dass es nicht wichtig wäre, dass Vermittler*innen die ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsräume nutzen und versuchen zu erweitern. In einer diskriminierungskritischen Perspektive muss es jedoch darum gehen, die oben genannten Fragen an die unhinterfragten Grundfesten der Institution zu stellen und dabei den Veränderungsauftrag in der Chefetage zu verorten.
Es handelt sich bei Diskriminierungskritik um ein Bündel kritischer Konzepte, die die eigene Positionierung im sozialen Raum mit ihren Machteffekten und die eigene professionelle Haltung mitnehmen, geradezu brauchen, um sich in eine Anwendbarkeit bringen zu lassen. Wir möchten zum Schluss auf einige Konzepte, die der Diskriminierungskritik im Museum zugrunde liegen sollten, eingehen.
Leerstellen vs. Spiegel(ungen)
Vergleiche sind immer schwierig und meist ein Garant dafür, gelernte Ungleichheitsdimensionen geradewegs abzurufen. Vergleiche, die sich nicht machtkritisch reflektieren und die Ungleichheiten, die die aufgemachten Räume der beidseitigen Beschreibung durchziehen, nicht besprechbar machen, reproduzieren Hierarchien, Differenzen und Rangordnungen. In der westlichen Welt lernen wir in Dualismen, sind es gewohnt, etwas – uns selbst – über die Beschreibung, die Markierung der „Anderen“ zu verstehen. Was „groß“ ist, verstehen wir nur mit einem (imaginierten) Bild von dem, was „klein“ ist. Die Liste ist endlos erweiterbar: dick und dünn, leicht und schwer, arm und reich, schwarz und weiß … Und interessanterweise verbinden sich sofort Emotionen mit diesen Bildern, die vor allem in ihrer Dualität begründet sind. Unser duales, hierarchisches und machtreproduzierendes Wahrnehmungssystem wird täglich bestätigt, erweitert und nachgesteuert. Welche Seite der Dualität abgerufen werden soll, nehmen wir sofort wahr. Ja, es ist deutlich schwieriger, die Dynamiken der Reproduktion der Ungleichheitsdimensionen sichtbar – ausstellbar zu machen. Museen arbeiten mit Objekten, mit Artefakten – mit dem Haptischen. Sie zielen aber auf das Wahrnehmungssystem, und hier liegt bereits eine große Diskrepanz. Das lässt sich nur aus der Routine der Dualität bringen, wenn es in einen Zustand der Verstörung kommt und vor allem darin bleibt. Aus der Dualität auszusteigen, das, was das Vergleichen unmöglich macht, zu „zeigen“, Ungleichheiten sichtbar zu machen, ist zutiefst verstörend. Buchstäblich auf Leerstellen – auf leere Stellen – zu stoßen und diese mit dem eigenen Wahrnehmungssystem zu verbinden, könnte es demgegenüber ermöglichen, die Prozesse von Differenz(ierung) und Hierarchie(sierung) erlebbar und damit auch emotional verstehbar zu machen. Die Arbeit mit Leerstellen kann nicht nur kognitive Räume öffnen, sie öffnet auch eben jene physischen Räume für all die, die sich zuvor die Frage stellten „warum?“. Dies erfordert eine zutiefst intersektionale Herangehensweise und Arbeit. Beispiele einer gelungene Visualität von Leerstellen werden oft nicht zur Kenntnis genommen, weil sie als die (Kunst-)Produktionen der „Anderen“ gelten. BPOC-Arbeiten werden nicht als mehrheitsfähig und für alle relevant erachtet. Sonst würden Museumskurator*innen durchaus von Ausstellungen wie Homestory Deutschland und den Interventionen von Orten wie Xart Splitta und dem FHXB Museum lernen.
Weißsein vs. Vielfalt
Die Arbeit im Museum möchte alle erreichen und – vielleicht hier viel verheerender – alle einschließen. Mit einem exkludierendem „Material“ alle erreichen und einschließen zu wollen, ist an sich schon ein Problem. Denn auch hier stellt sich sofort die Frage „warum?“. Warum sollten die, die jahrhundertelang in, mit und durch dieses „Material“ exkludiert wurden, es nun interessant, spannend und vor allem für sich sinnvoll finden? Wenn das „Andere“ im Raum für die Erfahrbarkeit und Bestätigung des „Eigenen“ herangezogen wird, hört Vielfalt auf, vielfältig zu sein. In der „Spiegelung“ musealer Objekte wird eine „Vielfalt“ bedient, die in aller Ehrlichkeit eine ganz bestimmte „Einfalt“ bestätigt. Das „Viel“ sind die Anderen, die es braucht, um das „Ein“ in „Vielfalt“ wieder zentral zu wissen. Eine ziemlich unattraktive Sache für die „Vielen“. „Vielfalt“ ist eine toxische Reproduktion von Ausschlüssen, weil es Einschlüsse suggeriert und die rassifizierende Verfasstheit der ObjektSpiegelungen nicht aufbricht. Eine Annäherung an das Problem und die Richtung einer Überwindung dieser strukturellen Positionierungen lässt sich auch hier nur in der Besprechbarkeit der Ungleichheiten erzielen. Eine Spiegelung mit/in afrikanischer Kunst beispielsweise wird ohne eine zentrale Besprechbarkeit von Weißsein weiterhin in den bekannten Dynamiken verharren. Die Markierungen der „Anderen“ ist bekannt. Die Unmarkiertheit des Markierers – das, was Weißsein als universelles Ordnungsprinzip ausmacht – ist, was das „Viel“ erst ermöglicht. Einen Fokus auf Weißsein statt der Exponierung der „Vielfalt“ wäre ein Schritt hin zu einer RaumÖffnung und der Möglichkeit, die Frage nach dem warum neu zu beantworten.11
Positionalität vs. Traditionalität (der eigenen Widerständigkeit)
Eine ernstgemeinte Diskriminierungskritik bedeutet demnach, dass die Institution Museum aus der oben beschriebenen Ambivalenz austritt und eine – ihre – klare Position einnimmt. Der Kitzel der Subversivität im Spiel mit dem Traditionellem, das sich im selbstgeschaffenen Raum des Kritischen wähnt, ist – wie aufgezeigt – machterhaltend und reproduziert auch weiterhin Ausschlüsse. Nur in einer klaren Positionalität als Institution, die eine tragende gesellschaftliche Rolle in diesen Ausschlüssen spielt, wird es möglich sein, diese schrittweise abzubauen. Die Sesamstraßenfragen können dabei helfen, auf die Suche nach den Leerstellen, die die eigene Institution schafft und aufrechterhält, zu gehen. Sie werden aber nur helfen, wenn sie auf sich selbst gerichtet gestellt werden. Das ist, was Positionalität ausmacht. Es bedeutet, sich selbst nach der eigenen Verstrickung, den eigenen Privilegien, den eigenen Leerstellen im (Nicht-)Wissen zu befragen und diese Position zum Ausgangspunkt des konzeptionellen, organisatorischen, politischen, ökonomischen und kreativen Handelns zu machen. Ein solches Handeln entfaltet eine Perspektive, die einen Prozess der Veränderung ermöglicht. Abseits von moralisierenden Implikationen hat es nicht nur eine Bedeutung, sondern eine einflussreiche Veränderungskraft, mit diesem Prozess der Veränderung bei sich selbst – als Individuum in der Institution Museum – zu beginnen. Denn auch die beschriebene Verstörung ist eine menschliche, die sich nicht über die Institution erfahrbar macht, sondern über unsere individuelle Körperlichkeit. Das bedeutet, wenn das Museum der Zukunft wirklich „andere Körper“ in ihre Institution einladen und für sie kulturelle Erinnerung anbieten möchte, müssen die, die diese Institution tragen, ihre Positionalität gegenüber dem eigenen Gegenstand entwickeln. Darin steckt die eigentliche Widerständigkeit, die Veränderung erst möglich macht.
- Sylvia Wynter, „Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation–An Argument“, The New Centennial Review, Jg. 3, Nr. 3, Herbst 2003, S. 257–337, online unter: https://doi.org/10.1353/ncr.2004.0015 (30.6.2020).
- Dies und die folgenden Ausführungen vgl. Carmen Mörsch, Die Bildung der A_N_D_E_R_E_N mit Kunst. Eine postkoloniale und feministische Kartierung der Kunstvermittlung, Wien 2019.
- Pablo Quintero und Sebastian Garbe (Hg.), Kolonialität der Macht. De/Koloniale Konflikte: zwischen Theorie und Praxis, Münster 2013, S. 9. Vgl. auch: Aníbal Quijano, „Colonialidad del poder y clasificación social“, in: Giovanni Arrighi und Walter L. Goldfrank (Hg.), Festschrift for Immanuel Wallerstein, Journal of World Systems Research, Jg. 6, Nr. 2, Herbst/Winter 2000, S. 342–388. Special Issue, online unter: http://jwsr.pitt.edu/ojs/public/journals/1/Full_Issue_PDFs/jwsr-v6n2.pdf (25.1.2021)
- Carmen Mörsch, Die Bildung der A_N_D_E_R_E_N mit Kunst. Eine postkoloniale und feministische Kartierung der Kunstvermittlung, Wien 2019.
- Vgl. Fath Davis Ruffins, „Mythos, Memory, and History: African American Preservation Efforts, 1820–1990“, in: Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer und Steven D. Lavine (Hg.), Museums and Communities. The Politics of Public Culture, Washington 1992, S. 506–611.
- Vgl. das Statement der Vorsitzenden des Deutschen Nationalkomitees der ICOM, Beate Reifenscheid vom 11.11.2019 mit dem Titel „Gegen Unverbindlichkeit und Politisierung: Zur Neudefinition der Museen“, online unter: https://www.wissenschaftskommunikation.de/gegen-unverbindlichkeit-und-politisierung-zur-neudefinition-der-museen-32389/ (23.3.2020). Einen offenen Brief von Mitgliedern der ICOM Deutschland als Reaktion auf den Aufschub findet sich unter: https://www.openpetition.de/petition/online/offener-brief-an-die-vertreterinnen-von-icom-deutschland#petition-main (23.3.2020).
- María do Mar Castro Varela, „Verlernen und die Strategie des unsichtbaren Ausbesserns. Bildung und Postkoloniale Kritik“, Bildpunkt. Zeitschrift der IG Bildende Kunst, Wien 2007, online unter: https://www.linksnet.de/artikel/20768 (15.1.2021).
- Anderung ist dem Englischen othering entlehnt und ermöglicht es, Prozesse der Entfremdung und Dehumanisierung als genuine Anteile von strukturell wirksamen Rassismen auch in visualisierter Kunstvermittlung machtkritisch zu versprachlichen.
- Einführungstext der Ausstellung Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum, online unter: https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/unvergleichlich-kunst-aus-afrika-im-bode-museum (25.1.2021).
- Vgl. Projektbeschreibung, online unter: https://www.lab-bode.de/schulprogramm/schulprojekte/anders-sein/ (25.1.2021).
- Vgl. auch Katja Kinder und Peggy Piesche, Wahrnehmung: Wahrnehmung – Haltung – Handlung. Diskriminierungskritische Bildungsarbeit: Eine prozessorientierte Intervention, hg. von RAA Berlin 2020.