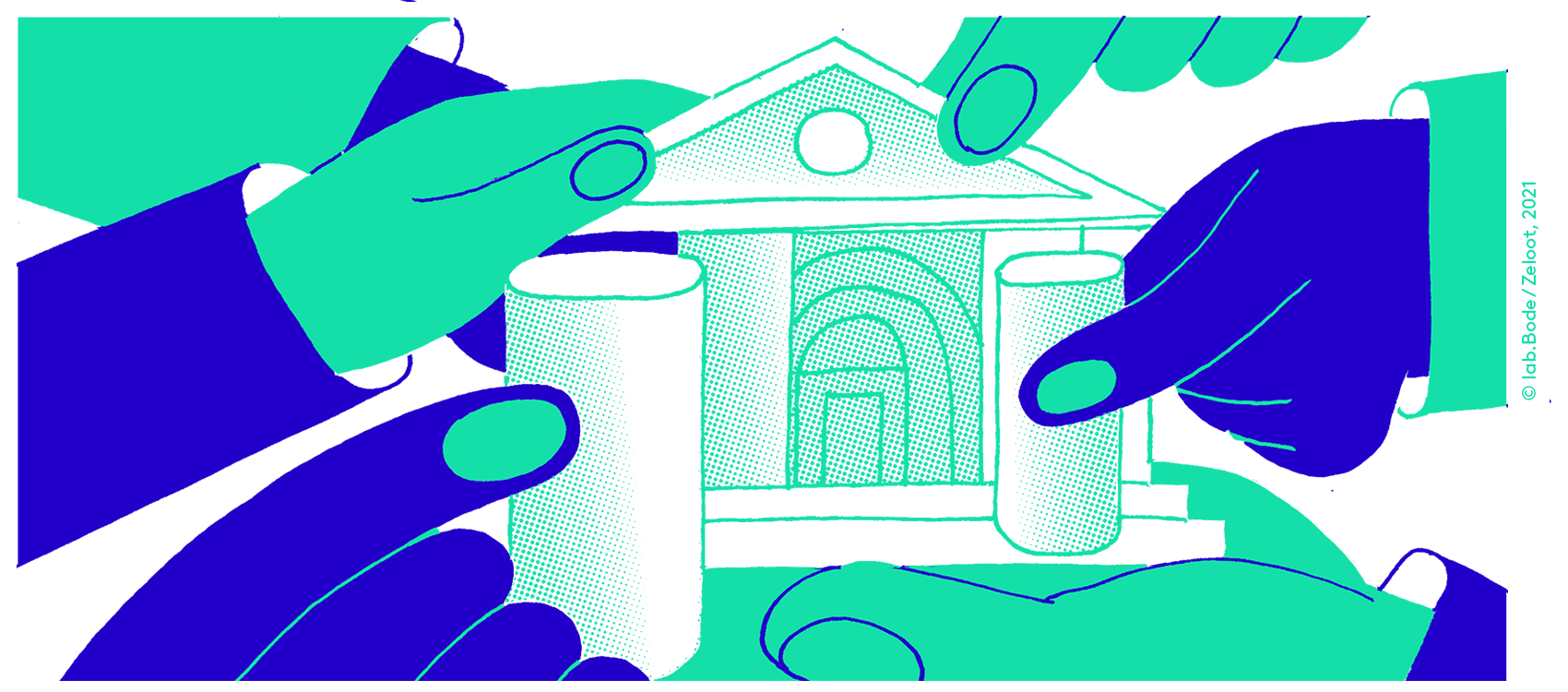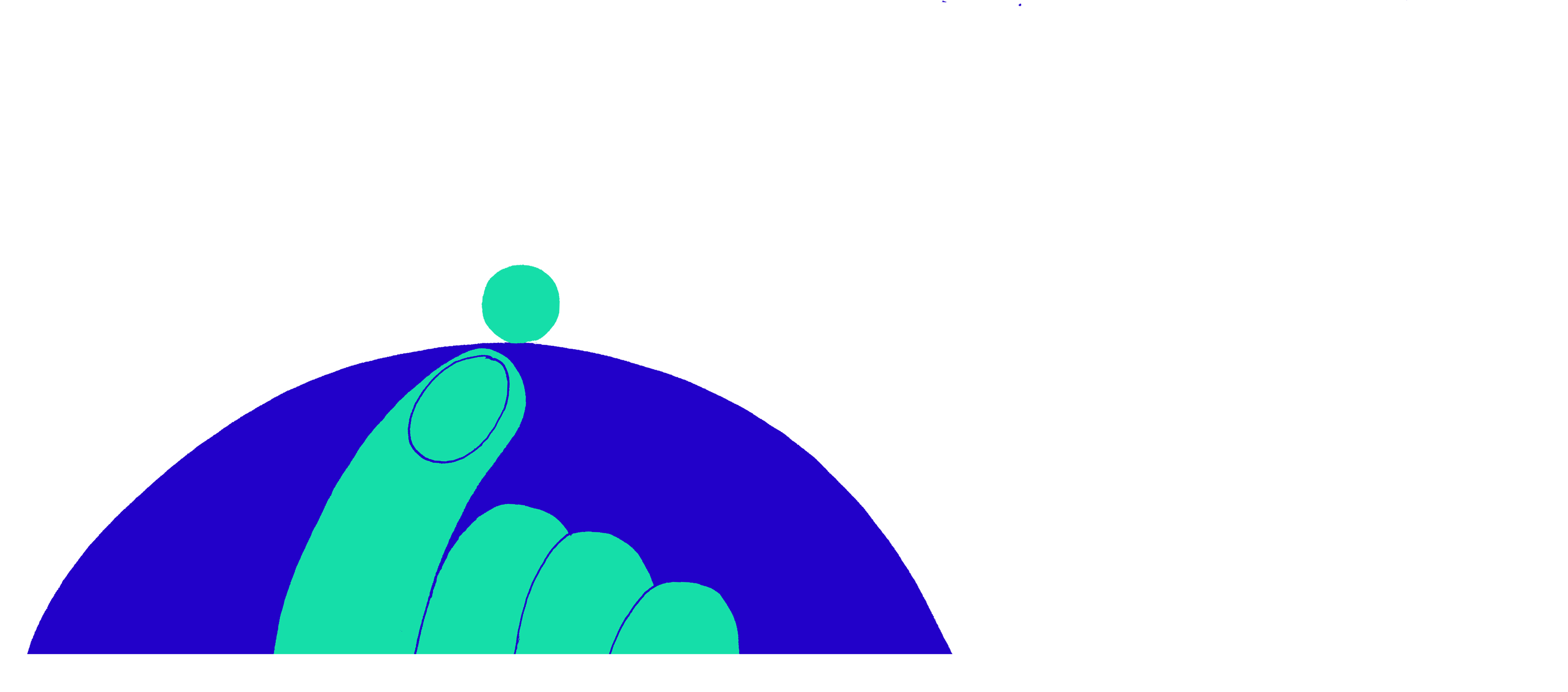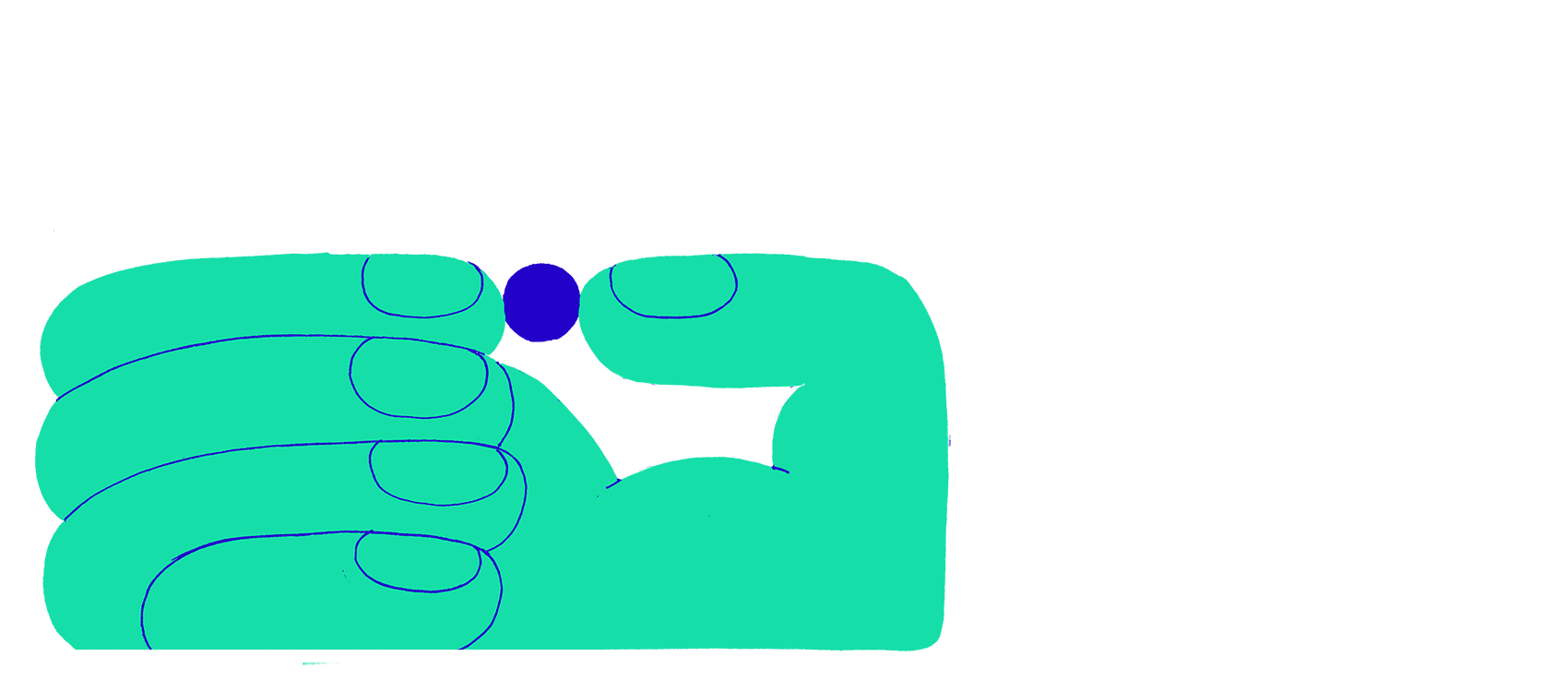Bevor ich das Projekt, „Hey Siri! Was ist ein Kurator?“1 zum Ausgangspunkt dafür nehmen, aus Sicht meiner Zusammenarbeit mit dem Jugendgremium Schattenmuseum und dem Künstler*innenkollektiv sideviews, die Frage zu bewegen, welche Möglichkeit(en) diese Zusammenarbeit für ein Museum und für die Besucher*innen eines Museums eröffnet, möchte ich die Genese des Jugendgremiums skizzieren und diese kontextualisieren.
Das Jugendgremium Schattenmuseum2 gründete sich 2018 ausgehend von einer Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Berlin. Es nannte sich Schattenmuseum, weil es die Idee verfolgte, eine „zweite Spur“ neben den existierenden Strukturen des Museums künstlerisch zu erforschen, Unsichtbares sichtbar3 zu machen und in den jeweiligen Kontexten der (Kultur-)Institutionen damit zu spielen. Seine Mitglieder hatten zwischen 2016 und 2018 eine Erfahrung gemacht, die Ausgangspunkt für den Wunsch war, ihre Perspektive in Museen einzubringen: Als Schulklasse waren sie nach einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Berlin eingeladen worden, eine Ausstellung zusammen mit Kurator*innen und der Programmdirektorin des Museums zum Thema „Jüdisches Leben heute“ zu kuratieren. Der einjährige Prozess gestaltete sich für alle Beteiligten als kompliziert und die Jugendlichen waren danach größtenteils enttäuscht. Das hatte verschiedene Gründe, die beispielsweise etwas mit gegenseitigen Erwartungen und Unerfahrenheiten in Bezug auf eine kollaborative Zusammenarbeit zu tun hatten, aber auch damit, dass nicht viel Zeit für die Entwicklung der Ausstellung existierte und die jeweiligen Kontexte Schule und Kulturinstitution unterschiedlichen Hierarchien, Zeit- und Kommunikationsstrukturen, Vorgehensweisen und Bedingungen u.a. folgen. Es ist viel Aushandlungsraum nötig, um gemeinsam einen Weg zu finden, aus dem etwas hervorgehen kann, das alle gleichermaßen entwickelt haben. Alle Beteiligten brachten entlang der institutionellen und persönlichen Bedingungen ihr Bestes ein, um Aushandlungsräume für die Zusammenarbeit zu eröffnen. Alle hatten Erfahrungen darin, mit anderen Personen zu kooperieren, und dennoch blieben die gemeinsamen Räume, rückblickend, stark in den Strukturen verhaftet, die das Museum anbot und nutzte und deren Codierungen eben auch den, im Museum tätigen Akteur*innen bekannt waren. Das heißt, ein Aushandlungsraum ist nicht gleich ein gemeinsamer Aushandlungsraum, den alle gleichermaßen zu nutzen wissen oder sich darin bewegen können.
Diese Erkenntnis erstaunt nicht weiter, wird in Betracht gezogen, was der Migrationspädagoge Paul Mecheril als Zugehörigkeiten beschreibt: „[Zugehörigkeiten] werden zu Kontexten klarer Grenzen und Regeln der Mitgliedschaft, zu einem imaginierten Raum einer oder mehrerer kultureller Lebensformen und zu einem Kontext der vorgestellten Zusammengehörigkeit und biographischen Verbundenheit“4. Museen, aber beispielsweise auch Schulen, sind solche imaginierten Räume. Ihnen liegt ein vertrauter Gemeinsamkeitskontext zugrunde, sie suggerieren Zuordnung und Zugehörigkeit. Sie basieren auf erlernten Praktiken, denen ein handlungsrelevantes Verständnis eines Regelkorpus zugrunde liegt. Anders ausgedrückt handelt es sich um kulturelle Handlungsräume, die mittels symbolischer Distinktionsmechanismen binäre Zugehörigkeitsordnung eines „Wir-NichtWir-Schemas“5 reproduzieren. Die postkoloniale Theoretikerin, Literaturwissenschaftlerin, Feministin und Pädagogin Gayatri Chakravorty Spivak formulierte 1984: „My project is the careful project of un-learning our privilege as our loss. I think it is impossible to forget that anyone who is able to speak in the interests of the privileging of practice against the privileging of theory has been enabled by a certain kind of production.“6 Sie verweist damit auf eine Dynamik zwischen Körpern, Räumen, Dingen und Sprache. Die soziale Praxis der Akteur*innen schreibt sich demzufolge auch in die Erzählung sozialer Strukturen ein. Privilegien werde entsprechend mit jeder Interaktion zwischen Körpern, Räumen, Dingen und Sprache erneut reproduziert. In der Konsequenz reproduziert der hegemoniale Diskurs auch nur das, was in ihn eingewebt worden ist. Ein Verlernen von Privilegien sollte dementsprechend als aktiver Prozess begriffen werden und Form, Inhalt sowie Protagonist*innen einbeziehen. Sie sind das Gewebe beziehungsweise die Textur7, die aus der Dynamik zwischen Körpern, Räumen, Dingen und Sprache entsteht. Es ist daher nicht erstaunlich, dass das Ringen um Positionen immanenter Teil dieses Prozesses ist: Es findet statt, wenn die vorhandene, als universell angesehene Textur ergänzt werden soll und kann eine Krise oder einen Konflikt auslösen, wie beispielsweise jene Erfahrung, die zur Gründung des Jugendgremium Schattenmuseum führte. Gewohnheiten werden befragt, gegebenenfalls umgeworfen, bekannte Regeln durchschritten, gegebenenfalls neu sortiert. Der Prozess des Hinzufügens ist anstrengend und mit einer epistemischen Gewalt verbunden. Und wie die Konzept-Metapher des „Einwebens“8 zeigt, kann die Erneuerung des „zerrissenen kulturellen Gewebes“9 nur durch ein Hineinweben, ein Hinzufügen der fehlenden Textur gelingen. Dieser Prozess basiert auf einer Umkehrung der Richtung von binären Oppositionen, wodurch die Gewalt aufgedeckt wird, die damit einher geht.10 Die postkoloniale Theoretikerin María do Mar Castro Varela unterstreicht, dass „[Neuordnungen] verunsichern, weshalb eine politische Bildung immer auf Widerstand stößt.“11 Es ist nicht nur ein aktiver, sondern auch ein schmerzhafter Prozess. Der Konflikt basiert darauf, anzuerkennen, dass soziale Produktionsverhältnisse und soziale Räume reproduziert, Unterscheidungen fortgeschrieben und Vergangenheiten nicht anerkannt werden. In diesem Sinne ist Teilhabe an mehr gebunden, als daran, eine Einladung für eine Zusammenarbeit auszusprechen und einen Aushandlungsraum im eigenen Kontext zur Verfügung zu stellen. Vielmehr muss ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass sich in die Praktiken und Regeln des Museums hegemoniale Strukturen eingeschrieben haben, die sich auch in den Praktiken, Begriffen und Konzepten seiner Akteur*innen widerspiegeln und die sich entsprechend entlang ihrer Interaktionen reproduzieren. Das Verlernen dieser Praktiken muss als aktiver und selbstkritischer Prozess der Reflexion begriffen werden, mit dem auch eine Übersetzung einhergeht, um die spezifischen Mechanismen zu erkennen. Erst auf dieser Grundlage wird eine Möglichkeit für ihre Verschiebung, ihre Hybridisierung oder ihre Neuorientierung wahrnehmbar. Denn das Hineinweben impliziert eine Verknüpfung partialer Sichtweisen.
Wird nun die Notwendigkeit eines Museums als Ort in der Gesellschaft vorausgesetzt, wie das der Philosoph und Migrationsforscher Ljubomir Bratić12 tut, ist aus seiner Perspektive damit der Appell verbunden, eine Institution zu schaffen, die alle einbezieht. Mit Bezug zur französischen Revolution und der Stürmung des Louvres, ist die Funktion des Museums, ihm zufolge, Veränderung in der Gesellschaft zu implementieren: „Das Museum ist also eine postrevolutionäre Institution, entstanden aus dem Geist der Revolution als Instrument, die Revolution in der Gesellschaft zu verankern.“13 Bratić weist damit einerseits auf eine immanente Spannung hin, in der sich Museen historisch befinden: eine Spannung zwischen revolutionärem und ruhigstellendem Moment. Andererseits scheint sich genau aus dieser Spannung die Funktion des Museums als Ort der Veränderung von Gesellschaft zu erklären. Wird der Widerspruch zwischen Verändern und Bewahren also zum Ausgangspunkt für die aktuelle Forderung nach Teilhabe herangezogen, könnte genau in ihm eine Möglichkeit liegen, die Grenzen und Regeln des imaginierten Raumes Museum zu verwischen.
In einem Interview über das Projekt „Hey Siri! Was ist ein Kurator?“ erzählen Mitglieder des Jugendgremium Schattenmuseum, dass es viel mehr Spaß macht, mit Kindern Experimente im Ausstellungsraum zu machen, als mit Erwachsenen, denn „die wollen immer so perfekt sein. […] Und sie wollen auch immer, dass alles einen Sinn hat, aber es muss ja nicht immer alles einen Sinn ergeben, um Spaß zu machen […] .“14 Die Experimente, von denen hier gesprochen wird, sind Teil einer Box, der SIRIBOX15, die in einem mehrwöchigen Projekt im Frühjahr 2019 von Grundschüler*innen entwickelt und produziert wurde. Das Jugendgremium Schattenmuseum begleitete das Projekt in peer-to-peer-Workshops. Im Spätsommer 2019 wurden einige der Grundschüler*innen Teil des Jugendgremiums, gemeinsam wurden sie von der Berlinischen Galerie eingeladen, die Box auszustellen. In der Box befinden sich unterschiedliche Experimente, die dazu einladen, sich interaktiv mit einem Kunstwerk zu beschäftigen. Im Winter 2019 konnten Besucher*innen die interaktiven Experimente der SIRIBOX in der Berlinischen Galerie ausprobieren. Das Jugendgremium Schattenmuseum kuratierte die Ausstellung. Auf der Finissage verteilte das Gremium die ersten fünf handgefertigten Boxen an ausgewählte Personen mit der Auflage, etwas mit der Box zu machen. Interessent*innen konnten sich mit einer Idee auf die Box bewerben. So bewarb sich beispielsweise das Team der Vermittlung der 11. Berlin Biennale. In einem gemeinsamen Workshop mit Mitgliedern des Gremiums lernten sie die Experimente der SIRIBOX kennen und entwickelten auf dieser Grundlage ein Toolkit für Familien, die damit über die Berlin Biennale laufen konnten.16 Die Klasse, die die Experimente entwickelt hatte, lud regelmäßig eine Schulklasse ein, mit ihnen die Experimente in der Ausstellung auszuprobieren und der Ausstellungsmacher Marcelo Rezende, der mit dem Gremium an dem kuratorischen Konzept ihrer Ausstellung gearbeitet hatte, erhielt ebenfalls eine Box.
Er beschreibt sie als Werkzeugkasten mit dem jede*r etwas Eigenes, seine*ihre persönliche Erfahrung mit einem Kunstwerk machen kann.
Er vergleicht die SIRIBOX mit einer Pappschachtel, die „[…] in Fillious Augen keine neutrale Wahl [ist] und es auch nie sein [könnte]. Im Gegenteil. Sie ist eine radikale Lösung, um einen Prozess im Kopf zusammenzufassen. Der Karton ist nicht für die Ewigkeit gemacht und verweigert die Vorstellung von Kunst (in unserem Fall auch Museum) als etwas Stabilem; auch hat der Pappkarton die Funktion eines Archivs. Er archiviert eine Chance, eine Möglichkeit.“17 Die Box verstanden als Archiv beinhaltet also als eigenständiger, vergänglicher, radikaler und nicht neutraler Raum eine Möglichkeit. Welche Möglichkeit ist das? Die SIRIBOX eröffnet zuerst einmal unterschiedliche interaktive Experimente ein Museum zu erkunden und eine Erfahrung mit den Werken zu machen. Aus dem selbstständigen Erproben und Experimentieren der Grundschüler*innen, zuerst in der Schule und später im Museum, sind Handlungsanleitungen entstanden, die in jedem Ausstellungshaus angewendet und erweitert werden könnten. Aber was ist daran interessant? Ich möchte einen kurzen Rückblick in den Verlauf des Projektes werfen.
„Hey Siri! Was ist ein Kurator?“ war von der Herausforderung begleitet, eine Museumsforschung ohne Museum18 zu machen, denn am ersten Tag des Projektes schloss die Berlinische Galerie. Zwei Schulklassen, drei Lehrer*innen und drei Künstler*innen standen vor der Aufgabe, ein Museum über vier Wochen in zwei Projekten zu erforschen, das sie nicht betreten durften. Die Berlinische Galerie blieb fast bis zum Ende des Projektes geschlossen. Entstanden sind verschiedene Entwürfe eines Museums in der Schachtel (Projekt 1) und unterschiedliche Experimente, um mit den Werken des Museums performativ in Kontakt zu treten (Projekt 2). Der Katalog der Sammlung wurde während der vier Wochen zum ständigen Begleiter der Schüler*innen und Künstler*innen: er war Inspirationsquelle, Forschungsgegenstand, Galerieraum, u.a. Als die Modelle drei Wochen später im Foyer der Galerie ausgestellt wurden, betraten die Grundschüler*innen des ersten Projektes erstmals das Museum. Die Künstler*innen beschrieben es als Explosion, denn die Schüler*innen erkannten überall Werke und suchten explizit nach ihren: nach den Werken, die in ihren Sammlungen, ihrem Entwurf eines Museums in der Schachtel, ausgestellt waren. Ein ähnliches Erlebnis beschrieben die Künstler*innen auch mit der zweiten Gruppe, deren spielerische Aneignungsinteraktionen im Museum überprüft und daraufhin weiterentwickelt wurden. Als die Modelle und Experimente im Anschluss in der Schule ausgestellt wurden, hatten die Projektteilnehmer*innen die Aula in einen Ausstellungsraum verwandelt. Die Souveränität und Selbstverständlichkeit, mit der die jungen Menschen die Besucher*innen in ihre Museen einluden und mit ihnen ihre Experimente durchführten, zeigte vor allem eins: Es waren ihre Dinge. Ihre Erfahrungen. Ihre Objekte. Ihre Geschichten. Ihre Erzählungen.
Deutlich wird, dass diese Museumsforschung ohne Museum dazu beigetragen hatte, dass die Schüler*innen sich bestimmte Werke aneigneten, indem sie Teil ihrer Museumssammlung oder ihrer interaktiven Formate wurden. Jedes Objekt, jede Erzählung, jede Geschichte und jede Erfahrung stellten eine Möglichkeit vor, sich mit der Sammlung, dem Museum oder einem spezifischen Werk performativ auseinanderzusetzen. Die Ausstellung in der Aula schaffte es darüber hinaus, ein Netz zwischen den Standpunkten der Schüler*innen und dem des Museums zu weben, sichtbar zu machen und zu einer „kollektiven Subjektposition“ zu verbinden. Und, die Experimente banden die Besucher*innen ein. Auch ihre Standpunkte konnten im Kontext der Ausstellung Teil dieser „kollektiven Subjektposition“ werden. Die Körper (Menschen und Dinge) wurden zu jenen veränderbaren und hybriden Konstrukten, die das Netz webten, das mit der feministischen Wissenschaftsphilosophin, Literaturwissenschaftlerin und Biologin Donna Haraway die machtförmig organisierten Positionierungen transformiert, ohne dabei alle Differenzen in einem zentralen Standpunkt auflösen zu wollen. Für einen Moment lang lösten sich die Grenzen des „imaginierten Raumes“ Museum auf.19 Haraway spricht von einer „Verknüpfung partialer Sichtweisen“, die sich in ihrem Konzept des „situierten Wissens“ als „kollektive Subjektposition“ verbinden.20 Das Verwischen von Grenzen und die Lust am Spiel mit Veränderbarkeit versteht sie dabei als Resultat und Voraussetzung allen Erkennens. Körper werden zu Ablagerungsorten von Interaktionen und Beziehungen.21 Explizit geht sie von einer inneren Differenz aus: Standpunkte sollen in Bewegung versetzt werden. Jede Position beschreibt einen Standpunkt, eine bestimmte Sichtweise und eine Perspektive. Und jede Interaktion kann eine Bewegung verursachen.
Als radikale Lösung fasst die SIRIBOX verschiedene Möglichkeiten zusammen, mit einem Kunstwerk in Interaktion zu treten. Als Archiv ist sie erweiterbar, sammelt Gedanken, Erfahrungen, Ergänzungen, Notizen, Aneignungen und das Wider- und Erfinden eigner Erzählungen und Ideen. Sie ist selbst Ablagerungsort von Interaktionen und Beziehungen. Sie kann weitergebene werden, wandern und ihre*n Besitzer*in wechseln. Sie ist vergänglich, beweglich und erweitert ihr Wissen mit jedem neuen in-Kontakt-treten mit einem Körper (Menschen und Dinge). Dabei eröffnet sie Aushandlungsräume über und mit den Kunstwerken, mit dem Ausstellungshaus selbst und zwischen verschiedenen Akteur*innen. Wie weiter oben beschrieben ist ein Aushandlungsraum nicht gleich ein gemeinsamer Aushandlungsraum. Mit der SIRIBOX hat das Jugendgremium Schattenmuseum allerdings einen Ort geschaffen, durch den die Körper miteinander in Interaktion treten können und ihre Beziehungen zueinander verändern, indem ein aktiver und selbstkritischer Prozess der Reflexion die Standpunkte in Bewegung versetzt. Der Aushandlungsraum, den das Jugendgremium auf der Grundlage der Box entwickelt hat, verknüpft partiale Sichtweisen mittels interaktiver Erfahrungen miteinander und eröffnet die Möglichkeit für Verschiebungen und Neuorientierungen. Sie ist das Werkzeug, das diesen gemeinsamen Aushandlungsraum herstellt, obwohl sie im Sinne Fillious nicht neutral sein kann, archiviert die SIRIBOX eine Möglichkeit der Teilhabe. Nora Sternfeld spricht davon, dass es darum geht, eine Vision davon zu entwickeln, was sein könnte,22 ohne diese Vision schon zu kennen. Das Jugendgremium Schattenmuseum hat mit der Box eine solche Vision des Museums geschaffen, indem es die Box weitergibt, mit der Auflage sie zu ergänzen, persönliche Erfahrungen, Experimente, Gedanken, Objekte u.a. hinzuzufügen. Es hat einen Zwischenraum geschaffen. Ein Zwischen der Interaktionen und der Beziehungen. Als radikale Lösung könnte die SIRIBOX der Widerspruch zwischen Verändern und Bewahren sein. Sie spielt mit dem Widerspruch, sie untergräbt ihn, hebt ihn nicht auf, aber sie verwischt die Grenzen: die Grenzen zwischen Bewahren und Verändern, zwischen Zugehörigkeit und Teilhabe. Die Grenzen des imaginierten Raumes Museum werden im Spiel mit der SIRIBOX in Bewegung gesetzt.